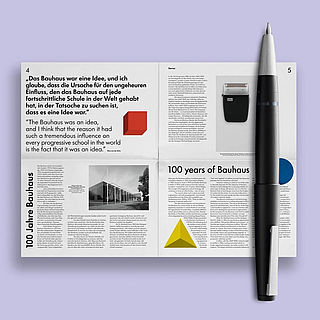Leiser Luxus
Über neue Werte und die Schönheit des Schlichten.
Von Gerrit Terstiege.

Eine spannende Frage: Was bedeutet Luxus heute? Wie hat sich unser Verhältnis zu Dingen von Wert und Qualität geändert? Geht es nach wie vor darum, unserer gesellschaftlichen Stellung sichtbaren Ausdruck zu verleihen?
Ohne Zweifel: Dieses Phänomen hat es immer gegeben, zu allen Zeiten und in allen Kulturen – und ganz verschwinden wird es sicher nie. Die Vitrinen der kulturgeschichtlichen Museen sind voll mit prunkvollen Artefakten, an denen sich sehr genau der Rang und die Bedeutung ihrer ehemaligen Besitzer ablesen lassen.
Doch mehr und mehr zeigt sich ein anderer, ein bewussterer Umgang mit den Dingen, die uns täglich begleiten, mit denen wir uns zeigen. Lange etwa galt das Auto als geradezu prädestiniert, um Wohlstand nach außen zu kommunizieren: Als Medium der Selbstdarstellung, als gänzlich öffentliches und symbolbeladenes Objekt, mit dem wir sozusagen fahrend eins werden, hat das Auto eine große Geschichte.
Der deutsch-amerikanische Kunsthistoriker Erwin Panofsky hat einmal den berühmten Kühlergrill des Rolls Royce untersucht und auf die Ähnlichkeiten zu antiken Tempel-Anlagen hingewiesen. Selbst John Lennon erlag seiner Aura und kaufte sich 1966 einen „Rolls Royce Phantom V Touring” – um ihn dann ohne zu zögern im Stil eines Zirkuswagens bemalen zu lassen: knallgelb, mit Blumen und Schnörkeln. Eine ironische Geste, mit der Lennon das klassische Statussymbol augenzwinkernd ad absurdum führte.
Und heute? Gerade Vertreter einer jüngeren, gutverdienenden Generation verzichten immer öfter ganz aufs Auto, nutzen Car-Sharing-Services oder investieren lieber in ausgezeichnete Rennräder oder Mountainbikes. Auch andere traditionelle Statussymbole wie kostbare Armbanduhren erfreuen sich längst nicht mehr der Beliebtheit wie einst. Viele, die sich durchaus eine teure Uhr leisten könnten, verzichten ganz darauf, einen Zeitmesser zu tragen – als sei dies der wahre Luxus: eben nicht immer und überall pünktlich sein zu müssen.
Understatement und Schlichtheit bestimmen auch zunehmend die zeitgenössische Architektur. Den Entwürfen ist nicht selten eine formale Strenge zu eigen, gepaart mit einer bewussten Materialwahl, einem vielleicht gar nicht äußerlich erkennbaren, cleveren Raumkonzept, energieschonenen Einbauten und vernetzten Anlagen.
Prunk und Protz, Säulen und klassizistische Anleihen gehören längst der Vergangenheit an. Namhafte internationale Baumeister wie Tadao Ando, Peter Zumthor oder Arno Brandlhuber setzen hier neue Standards einer leisen Architektursprache, die mit innovativen Ansätzen überzeugt, statt auf alte Vorbilder und Repräsentationsgesten zu bauen.
Und selbst im Design von Möbeln und Konsumgütern hat eine neue Schlichtheit Einzug gehalten, spätestens seit der Brite Jasper Morrison und sein japanischer Kollege Naoto Fukasawa das „Super Normal”-Design ausriefen, das in vielen Lebensbereichen auf eine archetypische Produktsprache zurückgreift, statt ins allgemeine Wettrennen um immer ausgefallenere Formen einzusteigen.
Plötzlich sieht bei Morrison ein Stuhl wieder aus wie ein Stuhl, ein Tisch wie ein Tisch! Diese neue Einfachheit, die gleichwohl in den Materialverbindungen, Farben und Details behutsam abgestimmt ist und durchaus mit produktionstechnischen wie formalen Innovationen aufwartet, führt zu einer neuen Schönheit der alltäglichen Dinge, die sie lange vermissen ließen.
Der in New York lebende Grafikdesigner Stefan Sagmeister hat jüngst, gemeinsam mit seiner beruflichen Partnerin Jessica Walsh, eine umfangreiche Studie zur Schönheit in Kunst, Design und Architektur vorgelegt, die als Buch und Ausstellung einem Manifest gleichkommt: „Wir glauben, dass die Schönheit selbst Funktion ist", heißt es da. Lange hat man nicht mehr solche Worte von Gestaltern gehört. Lange taugte allein alles Schräge, alles Ausgefallene, zur Distinktion: Mehr ist mehr! Luxus sollte auf den ersten Blick erkennbar sein, Schönheit und Funktionalität traten in den Hintergrund.
Dabei muss man sich fragen: Wie langlebig ist ein Design, das nur den neuesten Trends nachläuft? Und wie fragwürdig ist ein Zurschaustellen von Reichtum um seiner selbst willen in der heutigen Zeit, die wahrlich nicht arm ist an gesellschaftlichen Problemen?
Mit einem „leisen Luxus” dagegen könnte man eine gänzlich andere Haltung beschreiben: Eine, die den Wert eines Produkts erkennt, um seine Qualität und technischen Finessen weiß, die sich womöglich gar nicht dem flüchtigen Blick mitteilen. Vielleicht ist es an der Zeit sich zu vergegenwärtigen, wie wertvoll ein Gegenstand werden kann, der uns über viele Jahre begleitet. Auch dieser wird dann Ausdruck unserer Persönlichkeit – nur eben nicht auf dem schnellen Weg übertriebener Gesten und Effekte.
Im Kontext von Schreibgeräten kommt fraglos noch ein Aspekt hinzu, der nicht zu unterschätzen ist in einer Zeit sekundenschneller digitaler Kommunikation: Mit der Hand zu schreiben, sei es einen Brief oder einen Tagebucheintrag, bedeutet, sich Zeit zu nehmen – für sich selbst und für andere. Bedeutet Entschleunigung und Innehalten, mit der Möglichkeit, sich selbst zu überraschen. Gedanken festzuhalten, sich selbst zu reflektieren und der eigenen Persönlichkeit schriftlichen Ausdruck zu verleihen ist zweifellos kostbar.
Oder, um es mit dem Prager Kulturphilosophen Vilém Flusser zu sagen: „Schreiben heißt, sich der magischen Macht der Wörter zu überlassen.” Und genau dies könnte heute, in einer immer schneller und lauter werdenden Zeit, eine neue, eine leise Form des Luxus sein.